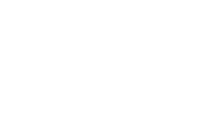Gero Hellmuth „…dass sie leben“
Ausstellung, Berlin – St. Matthäus im Kulturforum, 2003
Christhard-georg Neubert:
Mit den schweren Themen kennt er sich aus, seit vor Jahren sein weithin bekannter Hiob-Zyklus entstand, jene sperrigen Metallreliefs, Skulpturen aus Stahl und Holz, die in immer wiederkehrender Variation das Aufbegehren des menschen gegen erlittenes, unverschuldetes leiden thematisieren. Demaler, Zeichner und BildhauerGero Hellmuth – geboren 1940 – ist dieser Hiob nah und verständlich, ders scharf die Ideologie bestreitet, wer leide, sei verstrickt in Schuld und empfange die Strafe zurecht. Das biblische Buch Hiob verunsichert alle pausbäckige Redevom gerechten Gott, denn es bietet das Bild eines unfassbaren Gottes, der das Leiden eines Rechtschaffenen zulässt. Es ist die so ost in der Malerei wie in der Literatur weitererzählte Geschichte des menschen, der vor der Fremdheit, Unnahbarkeit Gottesfast zerbricht, aber schließlich doch sich gerettet, geleibt und aufgehoben weiß in Gottes Hand.
Der hier präsentierte Auschwitz-Zyklus erscheint ohne die Vorarbeit im Hiob-Zyklus kaum denkbar. Auch hier formuliert der Künstler jene persönliche, ins unermesslich gesteigerte Krise, die ungezählte, in den Grundfesten ihres Gottesglaubenserschütterte menschen zurückließ, haltlos, entwurzelt, irre geworden an allem, was Sinn verhieß. Und doch spiegelt sich in den neuen Arbeiten gero Hellmuthsdas Hoffen auf Möglichkeiten und Verwandlung, zu einem Aufbruchins Offene, aus dem Verstummtsein dse mit der Häftlingsziffer Gezeichneten hinausin ein neues vertrauen “ …dass sie leben“.
Es ist die Zuversicht und das Streben nach einer Überwindung des Schreckens, die Gero Hellmuths Auschwitz-Zyklus und die von ihm inspirierte Kantate ° … dass sie leben“ von dem israelischen Komponiste Joseph Dorfman wie zu einem Gesamtkunstwerkverschmelzen lassen. Beide Werke stehen zueinander wie zwei Spiegel, in deren Brennpunkt sich das Hesekiel-Zitat zu einem Credo verdichtet.So wie Gero Hellmuth in seinem Befreiungs-Triptychon, Herzstück des Auschwitz-Zyklus‘, die Entwicklung von der Vernichtung des Menschen hin bis zu seiner Befreiung nachvollzieht, strebt Joseph Dorfman in seiner Musiknach einer Auflösung der Finsternis in Transparenz.
Das Besinnenauf die gemeinsamen Wurzeln, Verbindendes wie Trennendes in gemeinschaftlich ausgerichteten Kulturprojekten zum Theme zu machen, ist mehr denn je zentrale Aufgabe der heutigen Gesellschaft und erklärtes Ziel der evangelischen Kulturstiftung St. Matthäus. Die Förderung des christlich-jüdischen Dialoges hat in diesem Zusammenhang oberste Priorität. (Auszug)
Siehe dazu die Laudatio von Ursula Prinz (s. Literatur)